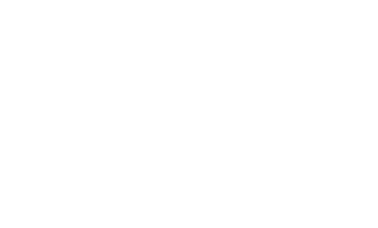
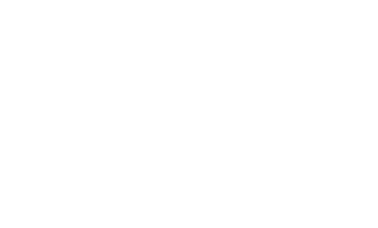
Vernehmlassungsantwort zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin (Bioethik-Konvention)
Obwohl erst eine begrenzte Diskussion über die Bioethik-Konvention
stattgefunden hat, finden wir es positiv, dass wenigstens im jetzigen
Zeitpunkt
eine Vernehmlassung durchgeführt wird.
Eigentlich hätte man bereits vor der Ausarbeitung eine breite
öffentliche
Diskussion und ein Vernehmlassungsverfahren auslösen müssen.
Wer jedoch die
lange Geheimnistuerei um die Bioethik-Konvention kennt, versteht, dass
dies nur
ein frommer Wunsch bleiben konnte. Nun, wo wir vor vollendeten Tatsachen
stehen, müssen wir uns fragen, mit welcher demokratischen Legitimation
und vor
allem mit welchem Auftrag die Schweizervertretung Einfluss auf den
Inhalt des
jetzigen Vorschlags genommen hat.
Im Bewusstsein, dass wir jetzt nicht mehr - wie in schweiz-internen
Vernehmlassungsverfahren üblich - auf den Inhalt dieses unserer
Ansicht nach
sehr schlechten und menschenfeindlichen Vertragswerks Einfluss nehmen
können, müssen wir das "Übereinkommen über Menschenrechte
und
Biomedizin" und dessen Ratifizierung durch die Schweiz strikte ablehnen.
Kritik am Verfahren
Wir kritisieren das bundesrätliche Verfahren, weil die Vernehmlassungs-
Unterlagen unvollständig sind, und der Vernehmlassungsbericht
teilweise
unseriös und einseitig ist.
Die wohlklingenden Erläuterungen im Vernehmlassungsbericht des
Bundesrat
sind auf die schweizerische Rechtslage bezogen. Für die Auslegung
des
Konventionstextes sind jedoch die in französischer (und englischer)
Sprache
abgefassten verbindlichen Erläuterungen des Europarats massgebend.
Eine
deutsche Übersetzung dieses wichtigen Dokuments fehlt. Dass uns
die
Erläuterungen in deutscher (und italienischer) Sprache vorenthalten
werden,
halten wir für unsauber. Jedenfalls fehlt der Öffentlichkeit
so die
Grundvoraussetzung für eine "informierte Zustimmung" zur Bioethik-Konvention.
Wir verlangen deshalb die Wiederholung des Verfahrens unter Beilage
der
kompletten deutschen Übersetzung der Erläuterungen des Europarats.
Im Vernehmlassungsbericht wird, wie deklariert, primär die (naheliegende)
"Vereinbarkeit des schweizerischen Rechts mit dem Übereinkommen"
dargelegt.
Der Bericht ist denn auch voll von "Trost" zuhanden der Forschenden,
im Sinne,
dass ein Beitritt zur Konvention keine Verletzung schweizerischer
Forschungsfreiheiten bedeuten würde, also keine Einschränkung
bisheriger
Tätigkeiten zur Folge hätte. Auf die verbindlichen Erläuterungen
des Europarats
wird zu wenig eingegangen. Dabei wäre gerade das nötig und
wertvoll für die
Abschätzung der Auswirkungen eines Inkrafttretens der Bioethikkonvention
oder
gar eines Beitritts dazu.
Der Bericht lässt stellenweise eine einseitig voreingenommene Haltung
des
Bundesrats erkennen. Zum Teil schimmern sattsam bekannte und unhaltbare
Aussagen von Forschungsvertretern durch, wie sie zum Teil schon in
der
Auseinandersetzung um die Genschutz-Initiative zu Tage traten. Zum
Beispiel
dort, wo uns der Bericht einen Rückfall in frühere Jahrhunderte
für den Fall
androht, dass man Grundlagenforschung an Einwilligungsunfähigen
verbieten
würde.
Vollends degoutant wird es, wenn uns der Bundesrat auf Seite 30 des
Berichts die
Forschung an einwilligunsunfähigen Menschen mit dem Argument schmackhaft
machen will, dass es "ethisch fragwürdig" sei, "wenn die urteilsunfähigen
Personen in diesen Kantonen" [wo nichttherapeutische Forschung an
urteilsunfähigen Menschen verboten ist] "von Forschungen, die
andernorts in der
Schweiz oder in der Welt durchgeführt werden, profitieren".
Dazu folgendes:
1. Der Bundesrat nimmt damit bereits Ergebnisse der Vernehmlassung
vorweg
und offenbart seine Absicht, das diesbezügliche Schutzniveau nach
unten an die
Bioethikkonvention anzupassen, also diesen Kantonen eine weniger strenge
Regelung aufzuzwingen.
2. Bekanntlich brachten auch die grausamen Menschen-Folter-Versuche
der
Nationalsozialisten gewisse medizinische "Erkenntnisse", die man auf
andere
Weise nicht erhalten kann, die einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn
darstellen und die unter Umständen sogar einmal einem Individuum
nützten...
Wer solche "Argumente" verwenden muss, betreibt reine Propaganda und
gerät
gefährlich nahe an das Gedankengut, wie es vor sechzig Jahren
in Deutschland
aktuell war.
Kritik an der Konvention
Allgemeines
Die Bioethik-Konvention geht davon aus, dass medizinischer Fortschritt
nur durch
massive Förderung der Biomedizin erreichbar ist. Viele Regierungen
und
Fachkreise fördern entsprechende Forschungsvorhaben einseitig.
Effiziente
Prävention und die Förderung vielfältiger Therapieansätze
kommen zu kurz.
Das Interesse an dieser Konvention liegt sowohl bezüglich Auslösung
und
Ausarbeitung wie auch bezüglich Umsetzung sehr einseitig auf der
Seite der
Forschungslobby. Also nicht etwa, wie der neue Titel vermuten lassen
könnte, bei
Menschenrechtsvertretern.
Eigentlich sollte man annehmen dürfen, dass die Menschenrechte
z.B. dank der
Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK genügend geschützt
sind. Fehlt
es allenfalls an der konsequenten Umsetzung?
Speziell gegen Auswüchse im Bereich der Medizin gibt es seit Ende
des 2.
Weltkriegs den Nürnberger Kodex, und gemäss internationalem
Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist Forschung ("Versuche")
an
Menschen, die keine Zustimmung geben (können), unzulässig.
Bekanntlich stellte ja der Rechtsausschuss des Europarates fest, dass
zumindest
die erste Version der Bioethik-Konvention die EMRK unterlief.
Bei genauer Betrachtung der Bioethik-Konvention stellt man fest, dass
bisher kein
anderes multinationales Regelwerk und kein Schweizerisches Recht ethische
Schranken, die man als gesellschaftlichen Konsens betrachten konnte
(z.B.
Verbot von Keimbahneingriffen oder Embryonenforschung), zugunsten der
Forschungsfreiheit in Frage stellt.
Nichts liegt näher, als dass es bei der Konvention nur um eine
Relativierung und
Aufweichung der Menschenrechte und bestehenden Schutzbestimmungen
zugunsten der Forschung am Menschen gehen kann. Menschenrechte gelten
nicht mehr absolut, sondern sollen unter Umständen hinter Forschungsinteressen
zurück treten.
Viele Artikel der Konvention, in denen es vordergründig um Grenzen
oder
Forschungsbeschränkungen geht, sind viel zu vage formuliert. Zündstoff
ergibt
sich nicht aus dem, was drin steht, sondern daraus, was nicht drinsteht
und
bestenfalls aus den Erläuterungen hervorgeht. Zu denken ist beispielsweise
an
die Artikel 12, 13, 17, 18, 20 oder 21 der Konvention. Das Wesentliche
wird auf
Zusatzprotokolle vertagt. Nur dort, wo die gesellschaftliche Empörung
schon
zutage trat (Stichwort Klon-Schaf Dolly), hat man flugs ein Zusatzprotokoll
kreiert,
um das Image der Bioethik-Konvention etwas aufzumöbeln.
Wenigstens haben wir in der Schweiz zu einigen dieser Problemfelder
konkretere
Regelungen (in Aussicht), die sich aus Art. 24novies BV ergeben.
Auch ist es verdächtig, wie von seiten gewisser Politiker im In-
und Ausland
versucht wird, mit dem unverfänglichen, weniger umstrittenen Zusatzprotokoll
des
Klonverbots Konventions-Kritiker wie Deutschland, Teile weiterer Länder
oder nun
auch kritische Kreise in der Schweiz ins Abseits zu manövrieren.
Denn Artikel 4 verunmöglicht die Annahme des Zusatzprotokolls,
ohne dass das
Hauptregelwerk angenommen worden wäre. Wenn dies die ursprüngliche
Absicht
für alle noch folgenden Zusatzprotokolle gewesen wäre, weshalb
hat eine solche
Einschränkung nicht bereits in die Haupt-Konvention Eingang gefunden?
Art. 12 der Konvention (Gentests)
Es wäre wesentlich glaubwürdiger, wenn hier ein klares Verbot
ausgesprochen
würde, und die wenigen Ausnahmen namentlich erwähnt würden.
Denn eine
regelmässige Überarbeitung der Konvention im Hinblick auf
die technologische
Entwicklung ist ja ohnehin vorgesehen, und Änderungen sind möglich
für den Fall,
dass sich Einschränkungen in gewissen Bereichen als zu restriktiv
herausstellen
sollten (siehe Bemerkungen zu Art. 32). So wie der Artikel formuliert
ist, muss
befürchtet werden, dass massive Missbräuche nicht zu verhindern
sind.
Art. 13 der Konvention (Genomeingriffe)
Der Gesetzesvorschlag erlaubt Veränderungen der menschlichen Keimbahnen,
falls diese nicht bewusst darauf abzielen, den Bauplan der Nachkommen
zu
modifizieren. Zitat des französischen Originaltextes: "...n`a
pas pour but..". Die
Auswirkungen und das Erzeugen ungezielter Keimbahnmanipulationen dürfen
somit untersucht werden. Auch hier sollte ein Verbot stehen und die
einzig
denkbare Ausnahme beim Namen genannt werden: Tumorbehandlung im Bereich
oder mit Effekt auf Keimdrüsen oder Keimzellen. Denkbar wäre
gewesen, alle
Spezialfälle, die ein solches Gesetz tangieren (z.B. Chemotherapie
von
Hodenkrebs), in Sonderregelungen aufzugliedern. "Erlaubt" sind damit
nämlich
sämtliche "unbeabsichtigen" Nebeneffekte einer somatischen Gentherapie
oder
anderer Eingriffe. Wie aber sollte z.B. jemand ausserhalb von
Wissenschaftskreisen beweisen können, dass einem Forscher oder
Mediziner ein
nicht unbeabsichtigter Nebeneffekt einer somatischen Gentherapie oder
einer
andern medizinischen Massnahme "passiert" ist? Für die genetische
Grundlagenforschung ist die körperliche Expression von genetischen
Veränderungen von allerhöchstem Interesse und wird juristisch
durch solche
Gesetzesformulierungen teilweise ermöglicht.
Art. 17 der Konvention (Forschungseingriffe bei Menschen, die
nicht
einwilligen können)
Absatz 2 ermöglicht, dass an einwilligungsunfähigen Personen
geforscht werden
darf, ohne dass die Ergebnisse für die Gesundheit der betroffenen
Personen von
unmittelbarem Nutzen sind, wenn die erhofften Untersuchungen und
Verständnisse einer Störung oder Krankheit letztlich anderen
Menschen der
gleichen Altersgruppe nützen können.
Solche Formulierungen stellen einen eigentlichen Freipass für
Experimente an
hilflosen Menschen aus und bergen ein ungeheures Missbrauchspotential
mit
sich. Die flankierenden Schutzbestimmungen sind im Ernstfall absolut
ungenügend, da die Konvention die Möglichkeit einer juristische
Intervention der
Angehörigen oder eine spätere persönliche Individualklage
des Betroffenen nicht
erwähnt. Auch die Gültigkeit von Art. 9 (zu einem früherem
Zeitpunkt geäusserte
Wünsche) wird in Art. 17 nicht aufgeführt.
Das Ermöglichen von Forschungseingriffen bei Menschen, die nicht
einwilligen
können, ist aus ethischen Gründen klar abzulehnen. Solche
Eingriffe und schon
nur die Rechtfertigungsversuche solcher Eingriffe sind
menschenrechtsverachtend und mit Kant und dem ethischen "Prinzip
Verantwortung" (Hans Jonas) unvereinbar.
Von gewissen "Ethikexperten" wird eine Individualethik postuliert.
Damit wollen sie
implizieren, dass keine Ethik berechtigt sei, jemandem ein Recht auf
eine
Heilungsaussicht vorzuenthalten. Dies ist inakzeptabel, denn Ethik
gründet auf
einer gesamtgesellschaftlichen Werthaltung. Die Frage ist doch, ob
die
Gesellschaft dazu genötigt werden darf, für potentielle Heilungschancen
Einzelner
den Preis unfreiwilliger Menschenversuche zu akzeptieren!
Im Widerspruch dazu definieren dieselben bioethischen Kreise ein kollektives
Menschenrecht, das unter Umständen ein individuelles Recht auf
Schutz ausser
Kraft setzt. Dies widerspricht unserer fundamentalen Werthaltung, wonach
kein
Menschenleben gegen andere aufgewogen werden darf:
Auch in Ausnahmesituationen wie Katastrophen darf niemand das Leben
auch nur
eines potentiellen Retters aufs Spiel setzen, um ev. das Leben von
100
Menschen zu retten.
Wer sich darauf einlässt, erzwingt eine Bewertung von menschlichen
Individuen
oder Menschengruppen in einem ökonomischen Sinn.
Art. 18 (Forschung an Embryonen in vitro)
Dieser Artikel überlässt es den staatlichen Rechtsordnungen,
ob sie die
Forschung an Embryonen zulassen. Gemäss Konvention soll die Forschung
an
überzähligen Embryonen, die sich aus der in-vitro-Befruchtung
ergeben oder die
aus Ländern importiert werden, wo sie für Forschungszwecke
hergestellt wurden,
erlaubt sein. Wir sind gegen jegliche Embronenforschung und sind der
Ansicht,
dass menschliche Embryonen unter keinen Umständen als Sache betrachtet
oder
als Experimentiermaterial dienen sollen.
Art. 21 (Finanzieller Gewinn, Patente)
Dieser Artikel möchte wohl verhindern, dass jemand aufgrund finanzieller
Aussichten seinen Körper vermarktet. An sich eine hehre Absicht.
Gleichzeitig
schafft er aber die Grundlagen für die Ausbeutung von "Menschenmaterial"
nach
traditionellem Muster: Der "Lieferant" des "Rohstoffs als solcher"
darf kein
Geschäft machen, wohl aber der Ausbeuter, Händler, Veredler
oder gar der
Inhaber geistigen Eigentums. Durch den Verzicht auf eine konkrete Regelung
zur
Patentierbarkeit menschlicher Ressourcen will sich die Bioethik-Konvention
hier
ganz klar die Möglichkeit offen halten, biotechnologische Erfindungen
zu
postulieren (ausser für Material im "natürlichen Zustand",
der "Lieferant" hat nichts
davon, siehe Fall Moore). Solche Tendenzen lehnen wir klar ab.
Art. 28 (öffentliche Diskussion)
Die im Artikel geforderte öffentliche Diskussion vor der definitiven
Verabschiedung
der Konvention hat nicht stattgefunden. Sie wurde unter anderem erschwert
durch
das Vorenthalten der rechtsverbindlichen Erläuterungen in deutscher
und
italienischer Sprache.
Art. 29 der Konvention (Auslegung)
Es ist unverständlich, dass weder Inhalt noch Auslegung noch Durchsetzung
der
Konvention vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
einklagbar
sein sollen. Dies belegt in unseren Augen nur allzu deutlich, dass
die Konvention
diesbezüglich offenbar Mängel und Angriffsflächen aufweist
und entsprechende
Anfechtungen zu befürchten hat. (Geradezu läppisch wirkt
dabei der Verweis auf
die Überlastung des Gerichts im Vernehmlassungsbericht.)
Art. 32 der Konvention (Überarbeitung und Änderung)
Dieser Artikel lässt alle Wünsche (der Forschungslobby) offen:
Die Bio-Minimal-
"Ethik" soll der galoppierenden Entwicklung der Medizin-Technologie
angepasst
werden können. Nach unten, versteht sich.
Gemäss Absatz 4 soll die Konvention in einem Rhythmus von höchstens
5 Jahren
"überprüft" werden, "damit wissenschaftlichen Entwicklungen
Rechnung getragen
werden kann".
Es gibt ja nur eine denkbare Auslegung dieses Artikels (über die
sich die
Erläuterungen ausschweigen): Das Ermöglichen einer regelmässigen
weiteren
Aufweichung der Menschen-Schutznormen und -rechte in Anbetracht
erweiterter technischer Möglichkeiten. Wissen und Technologie
verschwinden
nicht, und damit existiert wohl kein Ereignis, das eine Verschärfung
von
Schutzbestimmungen nötig machen oder ermöglichen würde.
Die ethischen Grenzen sollen immer gerade ausserhalb des Gärtchens
gesteckt
werden, im dem gerade geforscht wird. Ethisch soll sein, was machbar
ist.
Zusatzprotokoll (Klonierungsverbot)
Das Zusatzprotokoll erwähnt eine Regelung der Klonierung am Menschen.
Dieses
formelle Verbot gilt allerdings nur sehr bedingt, da nur das gezielte
Klonen von
menschlichen Lebewesen unter das Verbot fällt. Auffällig
ist, dass die Definition
von "menschlichen Lebewesen" offen gelassen wird. Man darf deswegen
vermuten, dass das Klon-Protokoll den Einsatz von Embryonen als Ersatzteillager
erlaubt.
Nein zur Konvention, Nein zur Ratifizierung
Es ist nicht einzusehen, warum die Schweiz eine Konvention ratifizieren
soll,
welche keine strengeren Regeln enthält als die in der Schweiz
gültigen, und
wir mit oder ohne Beitritt volle Autonomie in der Gestaltung unserer
Regelungen behalten sollen.
Es gibt also keinen Grund für eine Ratifizierung, im Gegenteil:
Es ist voraussehbar, dass nach einem Beitritt eines Landes - auch der
Schweiz -
zur Konvention mit dem stereotypen Hinweis auf nationale "Forschungs-,
Denk-
und Arbeitsplätze" der politische Druck steigen würde, nationale
Regelungen
nach unten, also dem tieferen Standard der Konvention anzupassen.
Dass diese Gefahr besteht, beweist Artikel 27 der Konvention, wonach
dieselbe
nicht so ausgelegt werden dürfe (aber kann!), als verhindere sie
strengere
Schutzregelungen. Art. 27 ist damit lediglich eine Absicherung, dass
die
Konvention nicht als Begründung für eine Nichterweiterung
oder Aufweichung
von Schutznormen herangezogen werden kann (obwohl sie der Auslöser
solcher
Bestrebungen sein wird). Die Konvention schützt sich damit vor
sich selber.
Ökonomisch gefärbtes Opfer-Nutzen-Denken und die unsäglichen
"Güterabwägungen" sind mit den Menschenrechten absolut unvereinbar.
Welches
Rechtsgut sollte denn die Menschenrechte relativieren können?
Es darf nicht sein, dass in diesem Bereich ethische Ansprüche
gegen allfällige
wirtschaftliche Vorteile ausgespielt werden.
Es ist philosophisch unhaltbar und völlig inakzeptabel, wenn die
Menschenwürde
zum Gegenstand von "Güter"abwägungen verkommt. Menschenwürde
und
Menschenrechte sind unteilbar und unantastbar. Das "Übereinkommen
über
Menschenrechte und Biomedizin" gefährdet sie.
Aus all diesen Gründen lehnen wir das "Übereinkommen über
Menschenrechte und Biomedizin" und dessen Ratifizierung durch die
Schweiz strikte ab und bitten den Bundesrat, auf eine Ratifizierung
zu
verzichten.
Forum GenAu, Februar 1999